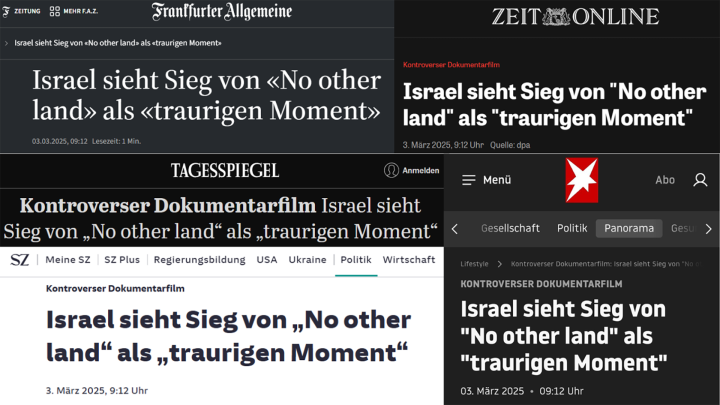Rassismus wird in weiten Teilen der israelischen Gesellschaft salonfähig. Regierungspolitiker haben ein einfaches Rezept, um dem Migrationsstrom Herr zu werden: abschieben und kriminalisieren.
»Wie bei der Kristallnacht«, »Ich sage nur 1933«, »Wir müssen sie nach Nord-Tel Aviv verfrachten«, »Eine Schande – als Jude sage ich das, und als Bürger dieses Landes«, »Es ist ein Problem der Immobilienpreise«, »Und vor ein paar Tagen war erst Yom HaShoah!« – Israels Blogosphäre bebt.
Am Freitagmorgen berichtet Online-Magazin 972mag, dass in der Nacht in der südlichen Tel Aviver Nachbarschaft Unbekannte Molotov-Cocktails auf vier von eritreischen und sudanesischen bewohnte Häuser und einen Kindergarten für Flüchtlinge geworfen hatten. Verletzt wurde keiner, aber es entstand erheblicher Sachschaden, und der psychische Schaden der Bewohner, darunter auch Kinder, wird sich erst später abzeichnen lassen. Anwohner und Politiker gehen von einem rassistischen Hintergrund der Tat aus. Die Polizei ermittelt.
»Hier kann ich mich frei bewegen, frei atmen. Hier verfolgt mich keiner«, sagte Mohamed, Flüchtling aus dem sudanesischen Darfur Anfang Januar bei einem Spaziergang entlang der polierten Jaffa-Straße in Jerusalem. Eine Woche vorher hatte er sich von Beduinen für 500 US-Dollar über den Sinai nach Israel schmuggeln lassen. Jacke, Pullover, Hose und Schuhe und seine Dokumente waren alles, was er mitgebracht hatte.
Die Flüchtlinge übernehmen die Arbeit, die selbst verarmende Israelis nicht mehr machen wollen
In Darfur gehört Mohamed zu einer ehemals einflussreichen Familie. Sein Vater fiel Anfang der 2000er Jahre in Ungnade und floh schwerkrank (die Familie vermutete, dass er vergiftet wurde) mit seinem Sohn Mohamed nach Kairo. Mohameds Vater starb bald. Mohamed blieb politisch aktiv, nahm an Workshops über friedlichen Widerstand teil, und kooperierte mit der revolutionären ägyptischen Jugendbewegung »6. April«. Von seinen fünf ägyptischen Freunden wurden seit der ägyptischen Revolution mittlerweile vier von Militärtribunalen zu Gefängnisstrafen verdonnert. Sich der Tatsache bewusst, dass er mit diesem Schritt auf lange Sicht nicht mehr in sein Heimatland Sudan zurückkehren wird, kam Mohamed Silvester dann nach Israel. Der Konflikt im Sudan bleibt ungelöst.
Seit Mitte der 2000er Jahre – zufälliger Weise zeitgleich mit Abkommen über Migrationsströme zwischen der Europäischen Union und dem im Oktober 2011 getöteten libyschen »Bruderführer« Muammar al-Gaddafi – strömen immer mehr Flüchtlinge, meist aus dem Sudan und Eritrea, nach Israel. Beduinische Stämme schmuggeln sie für ein Kopfgeld von 500 bis 30 000 US-Dollar nach Israel. Einige Beduinen kassieren das Geld und bringen die Flüchtlinge an die Grenze. Andere Clans betrachten insbesondere eritreische Flüchtlinge als Kapital, dass durch Erpressung der Verwandten oder Entnahme von Organen auszuschöpfen ist.
An der Grenze angelangt, zeigen die Beduinen den Flüchtlingen den Weg nach Zion, und dann heißt es, über Erdwälle oder Zäune auf die israelische Seite der Wüste zu kommen, bevor ägyptische Soldaten schießen. Trotz Revolution und der Abkühlung der Beziehungen mit Israel scheint der seit 2009 bestehende ägyptische Schießbefehl für illegale Grenzüberschreitung weiter durchgeführt zu werden. Vor zwei Tagen wurde ein Sudanese von der ägyptischen Armee beim Versuch der Grenzüberschreitung erschossen. Trotzdem sind seit Anfang dieses Jahres so rund 6000 neue Asylsuchende in Israel angekommen. Drei mal so viele, wie im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
In Israel übernehmen Flüchtlinge die Arbeit, die selbst verarmende Israelis nicht mehr machen wollen -– meist in der Tourismus-Branche und meist schwarz. Sie wohnen in eintönigen Siedlungen im Negev, werden in Camps bei Eilat aufgefangen oder hausen um den Busbahnhof im runtergekommenen Tel Aviver Süden. Im anliegenden Levinsky-Park schlafen dutzende Afrikaner in Zelten. Die Gegend, bekannt als »Klein-Afrika«, ist gesäumt mit afrikanischen Läden und Kneipen. Der Mobilfunkanbieter Orange macht mit hausgroßen Plakaten auf arabisch Werbung für Telefonraten in den Sudan.
Der rechtliche Status der Flüchtlinge ist unsicher. Arbeit ist weitestgehend verboten, Aufenthaltsgenehmigungen müssen halbjährlich verlängert werden. Das vom ultra-orthodoxen Schas-Vorsitzenden Eli Jischai geführte Innenministerium behindert Asylverfahren wo es nur kann. Anfang des Jahres verabschiedete die Knesset das »Gesetz zur Verhinderung der Infiltration«, dass es dem Innenministerium ermöglicht, Asylsuchende aus »feindlichen Ländern«, wie dem Sudan, die unerlaubt die israelische Grenze überquert haben, auf Jahre hinweg ohne Widerspruchsrecht und Untersuchung des Asylanspruches zu inhaftieren.
Jischai ließ im Frühjahr dieses Jahres verlauten, dass »alle 58.000 Eindringlinge das Land verlassen müssen«. Amnesty International verurteilt die Linie der Regierung scharf: »Inhaftierung ist eine unangemessene Reaktion auf irreguläre Migration. Es führt lediglich zu weiterer Stigmatisierung, kriminalisiert Migranten und treibt sie in den Untergrund. Der Begriff ›Infiltration‹ ist nicht angebracht und wird mit Bedrohung und Kriminalität assoziiert. Die Benutzung des Terminus durch Beamte und in der Öffentlichkeit entfacht Fremdenhass und Diskriminierung gegen Asylsuchende und Migranten.«
»Es ist bezeichnend, dass nur 300 und nicht 3000 oder 300.000 Menschen gegen diese Unmenschlichkeit demonstrieren«
Die harte Gangart gegen Afrikaner ist unter den Regierungsparteien weit verbreitet. Für Danny Danon vom regierenden Likud sind die »Eindringlinge die größte Bedrohung Israels«, und er fordert, dass sämtliche Afrikaner deportiert werden sollen. Der rechtsgerichteten Regierung von Benjamin Netanjahu wird vom rechtsextremen Siedlerspektrum Druck gemacht. Knesset-Mitglied Michael Ben Ari von der Nationalen Union, Siedler aus dem Westjordanland, Kahanist und in den USA wegen vermuteter Verbindungen zu jüdischen Terrornetzwerken unerwünscht, machte im Dezember letzten Jahres bei der Teilnahme an einer anti-afrikanischen Demonstration unter dem Motto »Tel Aviv für die Juden. Sudan für die Sudanesen« im Süden Tel Avivs Aufsehen. Ben Ari zufolge hätten es die »Eindringlinge« auf die Zerstörung des Staates Israels abgesehen, und würden von linken Aktivisten dabei unterstützt.
Die Stimmung im Einwanderungsland Israel schwingt gegen sudanesische und andere afrikanische Flüchtlinge, weil sie angeblich den »jüdischen Charakter« des Staates zersetzen. Sozio-ökonomische Spannungen im Land nehmen zu. Mit der erhöhten Sichtbarkeit afrikanischer Flüchtlinge verschärft sich die ablehnende Reaktion großer Teile der jüdischen Bevölkerung. Schwarze Einwohner, inklusive der jüdischen Einwanderer aus Äthiopien, sehen sich immer wieder Rassismus und Diskriminierung ausgesetzt, was erst im Januar den israelischen Präsidenten Schimon Peres dazu veranlasste »Hitlerismus« in der israelischen Gesellschaft scharf zu verurteilen. Auch der ehemalige Chef des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, Yuval Diskin, bescheinigt der israelischen Gesellschaft zunehmend intolerante Tendenzen: »Während der letzten 10 bis 15 Jahre ist Israel rassistischer geworden – ein Rassismus gegen Araber und Ausländer.«
Die Brandattacke in Shapira ist nicht die erste ihrer Art. Erst letzte Woche wurde ein brennender Reifen in eine von Sudanesen bewohnte Wohnung in Aschdod geworfen. Sieben Bewohner mussten wegen Rauchvergiftung ärztlich versorgt werden. Nizan Horowitz von der linken Meretz-Partei sprach von »einer Schande für die israelische Öffentlichkeit.«
Diese Öffentlichkeit bleibt allerdings angesichts der sich mehrenden fremdenfeindlichen Ereignisse und Angriffe gegen Andersdenkende und »Shitstorms« gegen linke Aktivisten relativ ruhig. Am Freitag morgen demonstrierten 300 Menschen in der Shapira Nachbarschaft gegen den Brandanschlag. Die Aktivistin Leehee Rothschild äußerte sich enttäuscht. »Es ist bezeichnend, dass nur 300 und nicht 3000 oder 300.000 Menschen gegen diese Unmenschlichkeit demonstrieren. Jedoch liegt es auch an uns selbst. Wir müssten viel mehr gegen die Regierung und die Knesset demonstrieren, die jeden Flüchtling in einen Kriminellen verwandeln, andauernd gegen Flüchtlinge aufhetzt und der Öffentlichkeit vermittelt, dass Gewalt gegen Flüchtlinge sie und das Land retten werden.« Verarmte israelische Anwohner in Shapira werfen den Aktivisten, häufig sozial besser situierte Tel Aviver aus dem Norden der Stadt, Scheinheiligkeit vor. Sie müssten in ihren Villen nicht mit den Afrikanern in direkter Nachbarschaft leben.
Gegen den Sündenbock-Reflex scheint es keine Impfung zu geben
Adam wurde mehrere Male in Darfur und in Khartum verhaftet und vom Regime des wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagten Omar al-Baschir misshandelt. 2005 floh er nach Kairo, wo er sich andauernder Diskriminierung aufgrund seiner Hautfarbe ausgesetzt sah. In Kairo las er auch das erste Mal in einem Buch über den Holocaust und darüber, dass Israel ein Land sei, dass von Flüchtlingen gegründet wurde. Seit 2008 ist er in Israel. Bereits 2006 setzte sich der Vorsitzende der Gedenkstätte Yad Vashem, Avner Shalev, in einem Schreiben an den damaligen Premierminister Ehud Olmert für die Aufnahme von Flüchtlingen ein: »Als Mitglieder des jüdischen Volkes, für das der Holocaust in brennender Erinnerung bleibt, können wir nicht tatenlos zusehen, wie die Opfer des Genozids in Darfur an unsere Tore hämmern. Die Erinnerung an die Vergangenheit und die Werte des Judentums verpflichten uns zu menschlicher Solidarität mit den Verfolgten.« Mittlerweile scheint sich die politische Klasse von diesen Prinzipien verabschiedet zu haben.
Die im letzten Sommer entstandene Protestbewegung »Zedek Chevrati –S oziale Gerechtigkeit« zeigt sich in sozialen Netzwerken bestürzt über die Attacken. Der Tel Aviver Bürgermeister Ron Huldai verkündet auf seiner Facebook-Seite, dass er von einem rassistischen Hintergrund ausgeht und dass solche Vorfälle völlig inakzeptabel seien. Auf Anfrage der Jerusalem Post, erklärt die Tel Aviver Polizei, dass sie nicht für jeden kleinen Zwischenfall ein Statement abgeben würde. Nach 24 Stunden dominieren dann wieder die Themen Iran, die Auswirkungen des Arabischen Frühlings auf die Beziehungen Israels mit Ägypten, und die näher rückenden Knesset-Wahlen das mediale Tagesgeschehen.
Das kleine Israel sieht sich mit einer weiteren Herausforderung konfrontiert. Mohamed mag der direkten politischen Verfolgung in seinem Heimatland Sudan und in Ägypten entkommen sein. Jedoch werden er und Adam auf Dauer nur geduldet werden, wenn sie mit einer Jüdin Kinder bekommen. Die sozialen, wirtschaftlichen und politischen Spannungen im Land nehmen zu. Das wirkt sich auch auf die Situation der Flüchtlinge und anderer Minderheiten aus. Gegen den Sündenbock-Reflex scheint es keine Impfung zu geben.