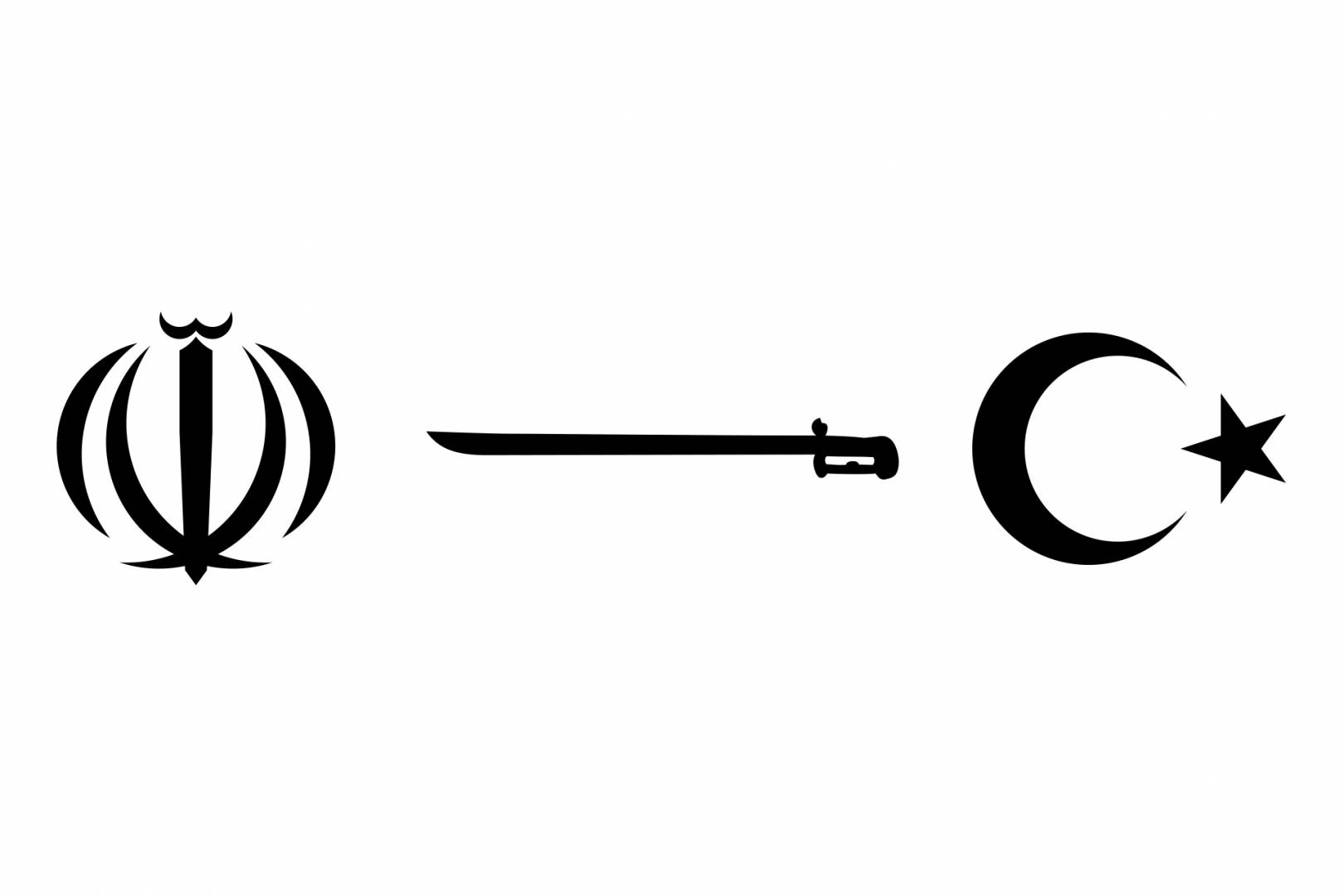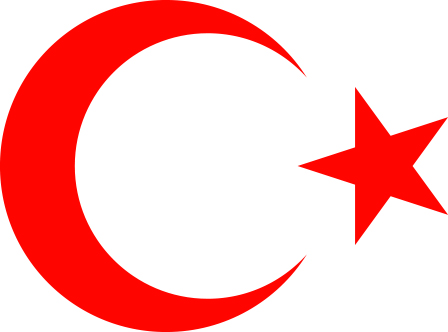Iran, die Türkei und Saudi-Arabien verfolgen in Syrien klare strategische Ziele. Und doch mussten die Regionalmächte im Verlaufe des Krieges ihre Positionen anpassen, überdenken oder gar über den Haufen werfen.
Iran
Macht des Schicksals
Als Saddam Hussein 1980 mit einem Offensivschlag den achtjährigen Iran-Irak-Krieg eröffnete, stellte sich weltweit nur ein einziger politischer Führer auf die Seite der frisch gegründeten Islamischen Republik Iran: Syriens Präsident Hafiz Al-Assad. Die Erlaubnis, syrischen Luftraum zu nutzen, war für Iran von elementarer Bedeutung. Das allein, hört man im politischen Diskurs in Teheran, sei ein wichtiger Grund, der Familie Assad – nun in der Person des Sohns und Nachfolgers Baschar – loyal zur Seite zu stehen.
Allerdings werden Loyalitätsbegründungen nicht reichen, um zu erklären, mit welcher Wucht und Bedingungslosigkeit Iran Assads Sturz gemeinsam mit Russland verhindert hat. Eine solche Einsatzbereitschaft, die Iran auf Jahre seine außenpolitischen Instrumente der »soft power« gekostet haben wird, kann nur auf existenzielle Sicherheitsinteressen zurückgeführt werden.
Die iranische Sicherheitsdoktrin wird seit der Staatsgründung 1979 von nahezu den gleichen Akteuren in der Elite gestaltet. Diese heute Mitte fünfzig- bis siebzigjährigen Herren sind größtenteils Veteranen des Iran-Irak-Krieges – viele von ihnen Kriegsversehrte. Ihr sicherheitspolitisches Denken ist geprägt von der traumatischen Erfahrung, dass ihre frisch gegründete Islamische Republik vom Nachbarn Irak mit der Unterstützung der gesamten Welt angegriffen und in einen hochgradig verlustreichen Krieg gezogen wurde. In ihnen schlummert noch heute eine tief verwurzelte Angst, Feinde (vor allem die USA und Israel) könnten das Land militärisch angreifen.
Auch wenn diese Angst bisweilen übertrieben anmutet, ist sie nicht von der Hand zu weisen. Schließlich war (und ist erneut) die militärische Option in Washington und Tel Aviv immer wieder auf dem Tisch. Der eigene ethnische und konfessionelle Minderheitenstatus in einer höchst fragilen Region steigert dieses Bedrohungsempfinden noch weiter. Noch viel wichtiger: Iran kann sich nicht auf eine Schutzmacht verlassen. Kein Land dieser Welt – nein, auch nicht Russland – wird zur Hilfe eilen, sollte Iran angegriffen werden. Zu guter Letzt: Irans Rüstungsindustrie setzt größtenteils auf eigene Produktion und ist keineswegs konkurrenzfähig mit den hochgerüsteten Nachbarn. Kurzum: Iran ist sich seiner militärischen Unterlegenheit gegenüber regionalen und überregionalen Widersachern absolut bewusst.
Aus dieser Erkenntnis heraus postuliert die iranische Sicherheitsdoktrin, sich den Feind so weit wie möglich vom Leib zu halten. Doch daraus ist mittlerweile eine vorwärtsgewandte Verteidigungsstrategie entstanden. Sie ist defensiv in ihrer Grundausrichtung, erfordert aber das proaktive Schaffen von Allianzen auf staatlicher und nicht staatlicher Ebene.
Und die ultimative sicherheitspolitische Allianz Irans ist das Band zur Hizbullah im Libanon. Anfang der 1980er Jahre wurde sie gegründet und bewaffnet, um den Südlibanon von der israelischen Besatzung zu befreien. Seitdem unterhält Iran die Hizbullah als Drohkulisse an der libanesisch-israelischen Grenze, damit – gemäß der iranischen Sicherheitslogik – Israel oder die USA nicht auf die Idee kommen, Iran militärisch anzugreifen. Man ist sich in iranischen Sicherheitskreisen einig: Gäbe es diese Front nicht, hätten die Israelis wohl die iranischen Atomanlagen bombardiert, so wie bereits in Syrien (2007) und im Irak (1981). Diese Drohkulisse hält Teheran aufrecht, damit weder Tel Aviv noch Washington oder mittlerweile Saudi-Arabien Irans Territorium zu gefährden wagen.
Das iranische Sicherheitsestablishment will diese Verteidigungsfront, die es ideologisch aufgeladen die »Achse des Widerstands« nennt und die Jordaniens König Abdullah II. einst »schiitischen Halbmond« taufte, mit wahrlich allen Mitteln intakt halten. Und genau deshalb besteht Teheran auf Assads Machterhalt. Ebenso wie sein Vater stellt Baschar sicher, dass Iran die Hizbullah militärisch aufrüsten kann – die berühmte »Landbrücke«.
Gleichzeitig versteht man auch in Teheran, dass es in Syrien auf Dauer eine politische Lösung geben könnte, in der Assad sein Amt räumen muss. Iran beteuert stets, dies könne nur durch Wahlen geschehen. Und sollte dann eine alternative Figur zu Baschar Al-Assad in Erscheinung treten, jemand, der das Territorium des Landes erhalten und gleichzeitig iranischen Zugang zur Hizbullah gestattet, ist durchaus denkbar, dass Teheran – ähnlich wie bei den Personalien Nuri Al-Maliki und Haidar Al-Abadi im Irak – eine Machtübergabe mit unterstützt. Von außen betrachtet ist es kaum denkbar, dass ein Hizbullah-Unterstützer Wahlen in Syrien gewinnen kann. In Teheran ist man fest davon überzeugt.
ADNAN TABATABAI ist Mitgründer des Center for Applied Research in Partnership with the Orient (CARPO) und Autor von »Morgen in Iran - die Islamische Republik im Aufbruch«.
Türkei
Imperium hängt zurück
Die Türkei entwickelte sich im Verlauf des Syrienkonflikts zu einem zentralen Akteur. Unmittelbar nach Ausbruch des Bürgerkriegs positionierte sich Ankara überhastet aufseiten der syrischen Opposition und forcierte die politische wie auch militärische Unterstützung der »Freien Syrischen Armee« (FSA) sowie sunnitisch-salafistischer Gruppen. Über die türkische Grenze reisten militante Kämpfer nach Belieben ein und aus.
Ankara antizipierte fälschlicherweise ein frühes Ende des syrischen Regimes. Man wollte auf der richtigen Seite stehen, wenn es so weit ist. Die Entschlossenheit Assads und seiner Verbündeten in Teheran und Moskau wurde maßlos unterschätzt. Nach sechs Jahren Krieg ist Machthaber Assad noch immer im Amt und geht scheinbar – so wie auch die syrischen Kurden – als Sieger aus dem Konflikt hervor.
Die Kurden unter der Führung der PYD konnten sich im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat internationale Anerkennung erkämpfen und kontrollieren nunmehr große Teile entlang der syrisch-türkischen Grenze. Die PYD (»Partei der Demokratischen Union«) ist die syrische Schwesterpartei der PKK, die seit über 30 Jahren Krieg gegen den türkischen Staat führt und von der Türkei, der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten als Terrororganisation geführt wird. Dennoch betrachten die westlichen Bündnispartner der Türkei es als angebracht, die PYD über deren militärischen Arm, die »Volksverteidigungseinheiten« (YPG), in Syrien zu unterstützen. Für Ankara ist das ein Schlag ins Gesicht, da ein kurdischer Staat entlang der gemeinsamen Grenze mit Syrien als existenzielle Bedrohung gesehen wird.
Statt also Großmacht zu spielen und einer Oppositionsbewegung zu einem Regimewechsel verholfen zu haben, ist die Türkei einer der großen Verlierer des syrischen Bürgerkriegs. Die syrische Opposition ist zersplittert, ineffektiv und radikalisiert. Die kurdische PYD genießt internationale Unterstützung und kontrolliert große Gebiete entlang der syrisch-türkischen Grenze.
Die Geschehnisse in Syrien beeinflussen Ankara in vielfacher Hinsicht. Dieselben IS-Kämpfer, die man noch über das eigene Grenzgebiet nach Syrien einreisen ließ, haben mehrere verheerende Anschläge auf türkischem Boden verübt. Somit verspürt die Türkei eine verstärkte Bedrohung sowohl durch die kurdisch kontrollierten Gebiete in Syrien als auch durch die derzeit eingedämmte, aber weiterhin bestehende Gefahr von IS-Terroranschlägen.
Die Türkei hat sich in Syrien mit einer unüberlegten und aggressiven Außenpolitik ins Abseits manövriert und besitzt wenig bis keinen Einfluss mehr auf die Entwicklungen im Nachbarland. Ankara wird zusehen und hoffen müssen, dass weder die PYD zu stark noch der (Rest)-IS und andere Terrorgruppen zu gefährlich werden.
ŞAFAK BAŞ dissertiert an der FU Berlin über die türkische und iranische Nahost-Politik und ist Associate Fellow bei CARPO.
Saudi-Arabien
Zur Not auch mit Assad
Der damalige saudische König Abdullah soll vor Wut geschäumt haben, als ihm zugetragen wurde, wie brutal der syrische Diktator Baschar Al-Assad im Frühjahr 2011 die Oppositionsbewegung im eigenen Land niederschlagen ließ und so das Land in einen blutigen Bürgerkrieg stürzte. Zu dieser Zeit hatte die saudische Führung noch den Versuch unternommen, Assad davon zu überzeugen, nicht mit aller Härte gegen die eigene Bevölkerung vorzugehen, sondern stattdessen den Ausgleich zu suchen. Doch damit biss der saudische König bei Assad auf Granit.
Seitdem hat sich Saudi-Arabiens Syrien-Strategie radikal umgekehrt: Die saudische Führung hat sich zu einem strikten Gegner des syrischen Regimes gewandelt. So betonte der saudische Außenminister Adel Al-Jubair im Oktober 2015: »Wir bleiben dabei, dass Baschar Al-Assad keine Rolle in der Zukunft Syriens spielen kann und dass er letztendlich gehen muss. Das haben wir immer gesagt und wir bleiben bei unserer Position.«
Um dieses Ziel zu erreichen, griff das saudische Königshaus auf eine Strategie zurück, die es schon früher eingesetzt hatte: Um Feinde zu schwächen, wird auch nicht davor zurückgeschreckt, militante Dschihadisten zu unterstützen. So soll der damalige saudische Geheimdienstchef Bandar bin Sultan zwischen Sommer 2011 und 2013 enge Verbindungen zu militanten Dschihadisten aufgebaut haben, die das Assad-Regime bekämpften. Doch je stärker und unberechenbarer diese Gruppen wurden, desto mehr fürchtete die saudische Führung, die Kontrolle über ihre Zöglinge zu verlieren.
Diese Erfahrung hatten sie einst mit Osama bin Laden machen müssen, der erst aus Saudi-Arabien unterstützt worden war, ehe er sich gegen seine saudischen Gönner wandte. Um dieser Gefahr vorzubeugen, wurde Bandar bin Sultan im April 2014 entlassen und die offizielle Unterstützung für syrische Dschihadisten drastisch reduziert. Weiterhin gerierte sich die saudische Führung als vehementer Gegner des »Islamischen Staates« (IS) und schloss sich der Anti-IS-Koalition an.
Damit begann eine neue Phase der saudischen Syrien-Politik, in der der Kampf gegen Assad keine Rolle mehr spielte. Stattdessen verschob sich unter dem neuen König und seinem Sohn, dem Kronprinzen Muhammad bin Salman, die Priorität der Außenpolitik weg von Syrien und hin zum Jemen. Dort hat sich Saudi-Arabien seit März 2015 als Speerspitze einer Militärallianz in einen blutigen Konflikt hineinziehen lassen, der die gesamte Aufmerksamkeit des saudischen Militärs beansprucht. In der Folge wurden Kampfjets, die in Syrien gegen den IS eingesetzt worden waren, nach Jemen beordert. Zwar galt Assads Sturz in der saudischen Rhetorik noch immer als Ziel, wurde aber nicht mehr aktiv betrieben.
Und mittlerweile scheint man in Riad sogar von dieser strikten Anti-Assad-Position abzurücken: Mit Sorge beobachtet man, dass das syrische Regime seine Position konsolidieren konnte und eine Zukunft ohne Assad wohl zur Utopie geworden ist. Und während der Kampf gegen den IS forciert wurde, ist es Teheran gelungen, seinen Einfluss in Syrien massiv auszubauen.
Dies ist der saudischen Führung ein Dorn im Auge, immerhin fühlt man sich seit 2011 zunehmend von iranischen Vasallen im Jemen, Irak, Bahrain, Libanon und eben auch in Syrien eingekreist. In Riad fürchtet man eine Entwicklung wie im Irak nach dem Sturz Saddam Husseins 2003. Solch ein Szenario wollen der 81-jährige Salman und sein Sohn unter allen Umständen vermeiden.
Auch deswegen reiste der König im Oktober 2017 nach Moskau, um sich dort mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zu treffen. Es war der erste Besuch eines saudischen Königs in Russland überhaupt. Dabei soll es auch um die Zukunft Syriens gegangen sein.
Der Besuch zeigt, dass sich die saudische Führung durchaus bewusst ist, die strikte Forderung nach einem Sturz Assads überdenken zu müssen. Es scheint, als schwenke Riad zähneknirschend auf einen pragmatischen Kurs um und suche die Nähe zu Assads Verbündeten. Saudi-Arabien verfolgt das strategische Ziel, den geringen Einfluss in Syrien wieder zu stärken, um damit den Erzfeind Iran zu schwächen und ihm nicht vollends die Bühne in einem Nachkriegs-Syrien zu überlassen.
SEBASTIAN SONS, Associate Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP), ist Autor von »Auf Sand gebaut. Saudi-Arabien – Ein problematischer Verbündeter«.