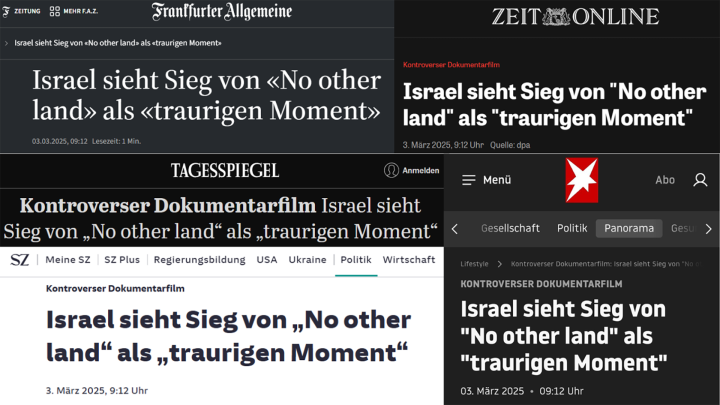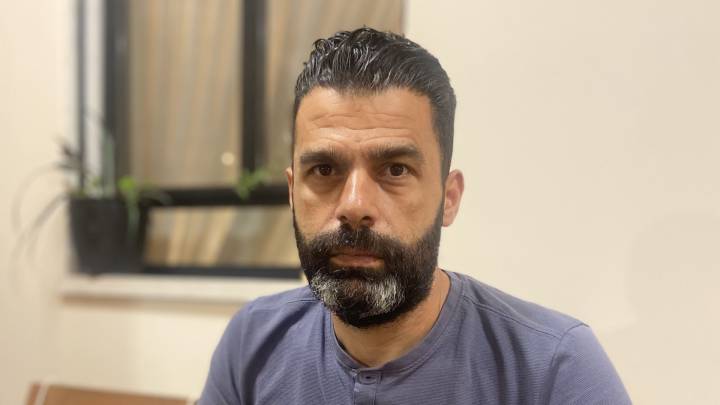Alle Welt redet über die Gefahr einer Ausweitung des Gaza-Kriegs in der Region. Im Libanon findet er längst statt. Eine Reportage.
Er ist der Kleinste und Jüngste von allen, aber Kassem weiß am meisten über Waffen. Über Drohnen und Panzer, er kennt die Unterschiede zwischen F14- und F16-Kampfflugzeugen und kann anhand der Wucht eines Einschlags einschätzen, wo dieser stattgefunden hat. »Ich weiß alles«, sagt er, und: »Ich habe keine Angst.« Das ruft er immer wieder, auch als sich seine Schwester Alaa nach einem vibrierenden Donnergrollen irgendwo draußen auf dem Schoß ihres Vaters zusammenkauert. Kassem hüpft barfuß zwischen seinen Eltern und Geschwistern umher, greift nach Barbiepuppen und Kabeln, die auf dem Boden liegen, aber nichts davon interessiert ihn so sehr wie das, was seit einem halben Jahr keine zwanzig Kilometer entfernt passiert.
Am 8. Oktober, einen Tag nach dem mörderischen Angriff der Hamas auf Israel, eröffnete die Hizbullah vom Süden des Libanon aus eine zweite Front. Sie schoss an diesem Tag Dutzende von Lenkraketen und Artilleriegranaten auf die unbewohnten, von Israel besetzten Shebaa-Farmen ab, die der Libanon als eigenes Staatsgebiet betrachtet. Eine Solidaritätsbekundung für den palästinensischen Verbündeten, denn als wichtigster Akteur in der von Teheran installierten Achse des Widerstands war die Hizbullah geradezu ideologisch verpflichtet, auf die von der Hamas ausgelöste »Al-Aqsa-Flut« zu reagieren.
Israel antwortete mit Drohnenangriffen und Artilleriebeschuss auf Stellungen der Hizbullah nahe der libanesischen Grenze zu den von Israel besetzten Golanhöhen. Aus den anfänglichen Scharmützeln ist längst ein Krieg geworden: Bis Ende März wurden mindestens 331 Libanesen getötet, darunter 57 Zivilisten, auch Frauen und Kinder.
Die anfänglichen Scharmützel haben längst die Dimension eines Krieges angenommen
Heiko Wimmen ist Direktor des Libanon-Projekts der International Crisis Group und lebt seit 1994 im Land. Er sagt: »Die Hizbullah hat diesen Krieg begonnen. Aber seitdem ist Israel auf der Eskalationsleiter immer ein, zwei Schritte nach oben gegangen – die Hizbullah folgt, wenn überhaupt.« Auf die Ermordung des Hamas-Funktionärs Saleh Al-Arouri Anfang Januar mitten in Beirut folgte ein Raketenhagel auf den Norden Israels und den strategisch wichtigen Luftwaffenstützpunkt Meron, der schwer beschädigt wurde. Doch die von Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah einst ausgerufene Gleichung »Stadt für Stadt (Beirut für Tel Aviv), Zivilist für Zivilist« kommt, bis jetzt, nicht zur Anwendung.
Dennoch: 96.000 Menschen wurden aus dem Norden Israels vertrieben, 100.000 aus dem Süden des Libanon. Bereits am 13. Oktober tötete die israelische Armee bei einem Luftangriff den libanesischen, klar als solchen erkennbaren Reuters-Journalisten Issam Abdallah, während seine Kollegin Christina Assi. Die für Nachrichtenagentur AFP arbeitet, so schwer verletzt wurde, dass ihr ein Bein amputiert werden musste. Wie Human Rights Watch und Amnesty International dokumentiert haben, setzt Israel seit Mitte Oktober immer wieder weißen Phosphor in grenznahen libanesischen Dörfern und auf anliegenden Feldern ein. Eine Chemikalie, die schwere Brände und immense Schäden für Mensch, Tier und Natur verursacht. Diese und andere Substanzen zerstörten die Lebensgrundlage tausender libanesischer Bauern, zehntausende Olivenbäume verbrannten, einige davon über tausend Jahre alt.
Kassems Vater Hussein und seine Frau, die ihren Namen nicht nennen will, gehören zu denen, die ihre Felder zurücklassen mussten. Sie wissen nicht, was aus ihnen geworden ist. Längst ist es zu gefährlich, dorthin zurückzukehren, und sei es nur, um nach monatelanger Flucht weitere Habseligkeiten zu holen. Bis zu sieben Angriffe pro Tag fliegt die israelische Armee inzwischen auf die Grenzregion, viele Dörfer im Süden des Libanon sind verlassen und zerstört. Zivile Infrastruktur wie Wohnhäuser und Schulen werden ebenso bombardiert wie Stützpunkte der Hizbullah und ihre Waffenlager. Darüber hinaus hat Israel bereits Städte wie Saida, nur 30 Kilometer von Beirut entfernt, oder Baalbek weit im Nordosten angegriffen.
Je näher Israel an Beirut und anderen Großstädten operiert, desto präziser werden die Schläge. Dann scheint die IDF genau zu wissen, welcher Hamas-Kommandeur sich wann in welchem Auto oder Haus befindet. Die Geheimdienstinformationen, über die Israel verfügt, beeindrucken Freund und Feind gleichermaßen.
Israel setzt in den grenznahen libanesischen Dörfern und auf den anliegenden Feldern immer wieder weißen Phosphor ein
Im grenznahen Süden scheint dieses Prinzip nicht zu gelten. Wer in von der Hizbullah beherrschten Gebieten lebt, muss damit rechnen, zur Zielscheibe zu werden. Dabei ist die »Partei Gottes« aus der Sozialstruktur des libanesischen Südens so wenig wegzudenken wie die CSU aus Bayern – was wiederum keineswegs bedeutet, dass die Mehrheit der Bewohner im Süden die Hizbullah aktiv unterstützen würde. Völkerrechtlich sind sie durch ihren Wohnort nicht weniger Zivilisten als etwa die Christen in den nördlichen Bergregionen des Libanon.
Als Entschädigung zahlt die Hizbullah Husseins Familie monatlich umgerechnet 85 Euro, im Ramadan das Doppelte. Vom libanesischen Staat, der nur noch als Farce existiert, kommen nicht einmal mehr Lippenbekenntnisse, als hätte man mit all dem nichts zu tun. Seit 2019 befindet sich das Land in der größten Wirtschaftskrise seiner Geschichte, die libanesische Lira hat 95 Prozent ihres Wertes verloren, mehr als 80 Prozent der Libanesen leben unter der Armutsgrenze. Seit den Parlamentswahlen im Mai 2022 ist die Regierung nur noch geschäftsführend im Amt, seit dem Auszug von Michel Aoun aus dem Baabda-Palast im Oktober 2022 hat das Land auch keinen Präsidenten mehr. Lange wurde der Libanon als Land am Abgrund beschrieben, dabei befindet er sich längst im freien Fall.
Hussein winkt ab, wenn die Rede auf die Regierung kommt. Er glaubt, dass er und seine Familie von diesem Staat nichts zu erwarten haben. Wenn überhaupt, dann helfen sich die Libanesen in der Not gegenseitig. Die Frau, die ihnen das Haus in Zrarieh zur Verfügung gestellt hat, hat es geerbt und lebt selbst nicht im Libanon. Dicke Teppiche bedecken den Boden, viel mehr gibt es nicht.
Katy Mroueh gehört zum Freiwilligenkomitee von Zrarieh, dem Dorf, in dem seit Mitte Oktober rund 145 Familien aus dem Süden Zuflucht gefunden haben. Es liegt direkt über dem Litani-Fluss, inmitten grüner Hügel mit leuchtenden Orangenbäumen, ein wenig versteckt wie das Auenland. Traditionell stark in Zrarieh ist die Kommunistische Partei, auch von ihr kommt Unterstützung für die Geflüchteten.
Ernten bedeuten mehr als nur Überleben, Tiere mehr als Nahrung, Olivenbäume mehr als Ertrag
Als die ersten ankamen, haben Mroueh und andere gleich gefragt, wer helfen kann, haben sich nach Häusern und Wohnungen erkundigt, die leer stehen, weil ihre Besitzer im Ausland leben. Dann suchten sie nach Matratzen, Möbeln, Kühlschränken. Alles wurde gebraucht – und alles bekamen sie von irgendjemandem umsonst. Auch die medizinische Versorgung sei für die Geflüchteten in Zrarieh kostenfrei. Die öffentlichen und selbst die im Libanon eigentlich teuren Privatschulen hätten die Kinder kostenlos aufgenommen. »Die Solidarität war von Anfang an sehr groß«, sagt Mroueh. »Wir Menschen aus dem Süden teilen ein Schicksal, so viele Jahre mit dem Feind direkt an der Grenze. Wir halten zusammen.«
1985 starben bei einem israelischen Luftangriff in Zrarieh rund 40 Einwohner, von 1982 bis 2000 besetzte Israel das Dorf. Auch einer der ersten israelischen Angriffe im aktuellen Krieg traf die Außenbezirke von Zrarieh. Der Krieg gegen Israel von 2006 ist vielen Bewohnern noch in Erinnerung. Ständig hört man auch heute wieder die Drohnen, die Bombeneinschläge, die Zerstörung. Die Geschichten derer, die zu ihnen fliehen, sind ihre Geschichten, der Schmerz ist ihr Schmerz, sagt Katy Mroueh. Und: »Viele waren zum ersten Mal seit 2006 wieder auf die Beine gekommen, hatten ihre Häuser repariert, konnten wieder von ihrer Ernte leben. Jetzt fangen sie erneut von vorne an.«
Die meisten, die hierherkommen, sind Bauern. Sie pflanzen Tabak, Oliven oder Weizen an. Auf der Flucht haben sie nicht nur ihr Zuhause, sondern ihr ganzes Leben zurückgelassen. Landwirtschaft ist ein fragiles, emotionales Geschäft. Erfolgreiche Ernten bedeuten mehr als Überleben, Tiere mehr als Nahrung, Olivenbäume mehr als Ertrag. Bauer zu sein stiftet auch Identität. Wer das aufgibt, tut das nur, weil die Alternative der Tod ist. Nach Angaben der Welternährungsorganisation FAO haben seit Beginn des Krieges 63 Prozent der Bauern im Süden ihre Höfe verlassen. Dabei macht die Landwirtschaft dort 80 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus.
Hussein erzählt, dass sein Heimatdorf Aita Al-Shaab 2006 ausgelöscht wurde. Nichts sei übriggeblieben. Er fürchtet, bei einer Rückkehr die gleiche Situation vorzufinden. Seine Frau sagt: »Die Familien versuchen, nicht zu weit wegzuziehen. Sie wollen in der Nähe ihrer Häuser bleiben«. Das Ehepaar berichtet, dass die Israelis von Anfang an die zivile Infrastruktur angegriffen haben: Häuser, Schulen, Solaranlagen, sogar medizinische Einrichtungen. Bleiben sei zu gefährlich gewesen. Für die Kinder seien die Einschläge besonders schlimm gewesen, die beiden Älteren seien bis heute völlig verängstigt. »Wir hatten einen Alltag, ein Leben«, sagt Husseins Frau. Sie selbst habe im Auftrag einer deutschen Organisation syrische Geflüchtete unterrichtet. Nun hat sie auch diese Arbeit verloren. Muhammad, der älteste Sohn, wird online unterrichtet, doch oft funktioniert das Internet nicht. »Wir haben nichts mehr.«
Sie erzählen, von Anfang an hätten die Israelis auch zivile Infrastruktur angegriffen
Ein paar hundert Meter weiter sitzen zwei Familien aus den Grenzdörfern Aytaroun und Chiyam auf Plastikstühlen zusammen. Die Erwachsenen rauchen, unterhalten sich, die Kinder spielen mit einer Katze. Nabil Haydar lebt mit seiner Tochter Ward, seinem Sohn Baher und seiner Mutter Sekna Eid auf engstem Raum. Kaum Licht dringt durch die schmalen Fenster in die Zimmer, in denen sich ihre verbliebenen Habseligkeiten an den Wänden und auf dem Boden stapeln. Ward zeigt in verschiedene Ecken des Hauses, die »Küche«, das »Schlafzimmer«, das »Bad« – ihr Vater ergänzt die Anführungszeichen mit den Fingern. Wafaa und Hassan Khalout haben mit ihrer Tochter monatelang aus dem Auto gelebt. Das Provisorium ist zum Alltag geworden, doch es ist schwer zu akzeptieren. Die Tage ziehen sich, die Decke ist ihnen längst auf den Kopf gefallen. Oft bleibt nur das Reden.
Dann geht es zum Beispiel darum, ob die Hizbullah sie gegen ihren Willen in diesen Konflikt hineingezogen hat. Doch dann ist sich die Runde einig, dass Israel für sie schon eine Bedrohung war, bevor es die Partei Gottes überhaupt gab, eigentlich seit 1948, wie sie sagen, ganz sicher aber seit den 1970er-Jahren. »Nicht alle im Süden unterstützen die Hizbullah politisch«, sagt jemand, »aber wir haben gesehen, wozu die Israelis fähig sind, sie haben unsere Felder zerstört, Journalisten und Zivilisten gezielt getötet. Solange Israel so handelt, werden wir keinen Frieden haben.«
Ein anderer fügt hinzu, dass die Hizbullah den Bewohnern des Südens Selbstbestimmung gegeben habe, vorher hätten sie jederzeit alles von Israel erwarten müssen. Jetzt gebe es jemanden, der sie verteidige. Als auf einmal eine Drohne wie ein wütender Bienenschwarm über der Gruppe schwirrt, sagt eine: »Man kann politisch gegen die Hizbullah sein und trotzdem für den Widerstand. Wir im Süden zahlen den höchsten Preis.«
Etwa 17 Kilometer südlich liegt die Hafenstadt Sour, eine der ältesten durchgehend bewohnten Siedlungen der Welt. Heute leben im ehemaligen Tyros rund 23.000 Menschen mehr als sonst, viele von ihnen in Schulen, die zu Auffanglagern umfunktioniert wurden. Nur mit Genehmigung darf man diese Zentren betreten, Hizbullah und Amal-Partei wachen darüber, wer mit den Menschen dort spricht. Sie wollen genau wissen, was so nahe an der Grenze passiert, die Israelis fangen massenhaft Kommunikation und Handydaten ab. Wenige Tage zuvor hatte die IDF den ersten Angriff auf Sour seit Beginn des Krieges geflogen, den Hamas-Funktionär Hadi Mustafa in seinem Auto mit einer Drohne attackiert.
Auch andere Farmer berichten von verendeten Tieren, ganzen Herden, die ausgelöscht wurden
Im Hof einer dieser Schulen sind Wäscheleinen gespannt. Nach dem Regen am Morgen ist es feucht, Nässe saugt sich in die Kleidung. Hier leben viele der Bauern, deren Felder Israel mit weißem Phosphor überzogen hat. Ein Mann aus Dhayra, wo Israel am 16. Oktober Chemiebomben abgeworfen hat, zeigt auf seinem Handy Fotos von verbrannten Feldern und Früchten, von Tausenden toten Bienen, die er über Jahre gezüchtet und gepflegt hat. Auch andere Bauern berichten von toten Tieren, ganze Herden seien ausgelöscht worden.
Bis zum 6. März wurden nach Angaben des libanesischen »Nationalen Rates für wissenschaftliche Forschung« (CNRS) 117 Phosphorbomben über dem Südlibanon abgeworfen. Insgesamt sollen fast zehn Millionen Quadratmeter Land verbrannt sein. Und die Angriffe gehen weiter. Weißer Phosphor ist eine hochreaktive chemische Verbindung, die sich an der Luft entzündet und beim Verbrennen große Hitze entwickelt. Er kann schwere Atemprobleme, akute Lungenschäden, Augenverletzungen, Verbrennungen zweiten und dritten Grades und sogar Knochenschäden verursachen. Nach Angaben der in Beirut ansässigen Organisation »Legal Agenda« wurden bis zum 21. November 100 Menschen mit Atembeschwerden oder Phosphorverbrennungen in Krankenhäuser im Südlibanon eingeliefert.
Amnesty International und Human Rights Watch haben Israel für den Einsatz von weißem Phosphor verurteilt, obwohl diese Waffe nicht per se international geächtet ist. Ursprünglich wurde sie eingesetzt, um Truppenbewegungen mit Rauch zu tarnen, auch Israel gibt an, sie zur Nebelerzeugung zu verwenden. Israelische Truppenbewegungen im Libanon hat es aber bisher nicht gegeben.
Antoine Kallab ist stellvertretender Direktor des AUB-Naturschutzzentrums, er sagt: »Weißer Phosphor hat neben dramatischen gesundheitlichen Konsequenzen einen immensen psychologischen Effekt. Es geht darum, einen unsichtbaren Feind, zu kreieren, der über Jahre hinweg eine kontinuierliche Bedrohung darstellt.« Wie ein stiller Tod, der Nahrung, Wasser und Luft infiltriere und mit der Zeit immer mehr schädige.
Wenn der Rauch sich verzieht, kristallisiert sich eine Theorie heraus, vor der Experten schon seit Längerem warnen
Wenn der Rauch sich verzieht, kristallisiert sich eine Theorie heraus, vor der Experten schon seit Längerem warnen: dass Israels Taktik daraus bestehe, langfristige und möglicherweise irreversible Schäden an der Umwelt, Landwirtschaft und Wirtschaft des Südlibanon zu verursachen, um ihn auf diese Weise dauerhaft unbewohnbar zu machen.
Ibrahim Al-Sayyed ist Bauer und Vater von elf Kindern, der älteste Sohn ist 29, die jüngste Tochter erst wenige Monate alt. Mit ihnen und seinen beiden Frauen lebt er in zwei umfunktionierten Klassenzimmern. Eigentlich hatte der 52-Jährige beschlossen, nicht mehr mit westlichen Journalisten zu sprechen, weil die dann nur schreiben würden, er sei Mitglied der Gruppe »Schiiten gegen den Krieg«, aber das stimme nicht. »Ich bin gegen den Krieg, na und?«, sagt er, hebt die Schultern, dreht die Handflächen nach oben und schaut, als warte er auf Reaktionen.
»Ich kann meine Familie nicht ernähren und weiß nicht, wie es weitergehen soll.« Es reicht nicht einmal, um seine Kinder so zu versorgen, dass sie zur Schule gehen können, also hängen sie den ganzen Tag aufeinander. »Aber besser gelangweilt als bombardiert«, sagt Al-Sayyed. Dass sich die Lage in absehbarer Zeit bessern wird, glaubt er nicht. »Ich sehe nicht, dass sich eine Seite beruhigt und Zugeständnisse macht.«
Das ist die große Frage, die seit dem 8. Oktober alle im Libanon beschäftigt: Wie geht es weiter? Heiko Wimmen, Landesdirektor der Crisis Group, ist vorsichtig optimistisch: »Noch beobachten wir eine Form strategischer Stabilität, in der sich beide Seiten an gewisse Regeln halten. Aber innerhalb dieses Spektrums entsteht Raum für taktische Instabilität.« Vor allem Israel teste sie derzeit aus. »Es funktioniert, bis es nicht mehr funktioniert: Wenn die Informationen dann doch mal falsch sind und in Baalbek ein Wohnhaus getroffen wird und hundert Menschen sterben«, erklärt Wimmen. »Oder das gleiche auf der anderen Seite, weil der Iron Dome versagt. Die Alternative lautet: Man findet eine Verhandlungslösung.«
Inzwischen glauben viele Libanesen, dass Israel mit der systematischen Entvölkerung und der Zerstörung von Feldern im Südlibanon versucht, eine Art Pufferzone entlang seiner Nordgrenze zu schaffen. Ein Ödland. »Sicherheit ist nie ein einseitiges Konzept«, sagt Wimmen. »Nur wenn beiden Seiten etwas angeboten wird, gibt es eine Lösung.« Für Hizbullah-Chef Hassan Nasrallah ist allerdings klar, dass Israel zuerst den Krieg in Gaza beenden muss.
Bis dahin bleiben den Geflüchteten nur ihre Erinnerungen. Irgendwann zücken sie alle ihre Handys und zeigen Fotos aus ihrem früheren Leben. Häuser, Felder, Ernten. Was davon übrig sein wird, wenn sie zurückkehren, das wissen sie nicht. Auch nicht, wann das sein wird. Nicht einmal Kassem weiß das.