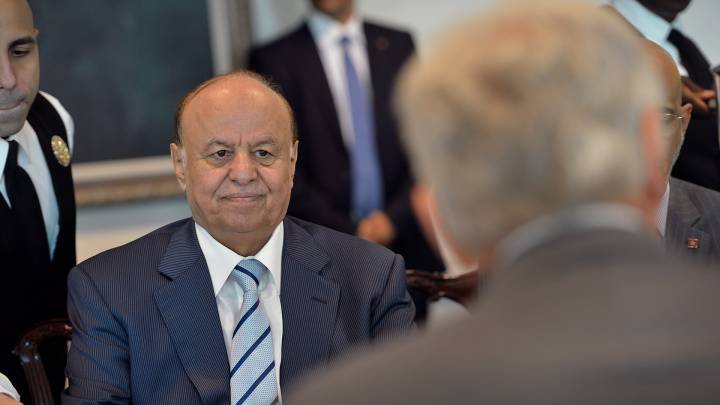Das politische Chaos droht die wirtschaftliche Zukunft Libyens zu verzehren. Im Osten des Landes träumen die Menschen indes von einem Wirtschaftswunder. Nirgendwo wird die Ambivalenz von Chance und Gefahr so deutlich wie in Benghazi.
»Vorsicht, eine Drohne« erschallt es aus der Menschenmenge. Verhaltenes Lachen. Es ist nur eine handgroße Kameradrohne, die über den Köpfen der Geschäftsleute surrt. Nur der Mann inmitten der rund zwei hundert Geschäftsleute kann sich kein Lächeln abringen. Ahmed Miitig, seit Mai 2014 neuer Libyscher Premierminister, ist sichtlich angespannt. Trotz seiner Wahl im Parlament ist sich der 43-jährige Hotelbesitzer aus Misrata nicht sicher, ob er Libyens einziger Regierungschef ist.
Und über der Hauptstadt Tripolis sind dieser Tage flugzeuggroße Drohnen zu hören, die islamistische Milizen im Visier haben, mit denen Miitigs Unterstützer im Parlament angeblich gemeinsame Sache machen. Und tatsächlich: Mitte Juni erklärte das Verfassungsgericht die Wahl Miitigs zum Premier für ungültig. Genügend Stimmen im libyschen Übergangsparlament, dem Nationalkongress, hatte er eine Woche zuvor erst erhalten. Allerdings erst, als der Vorsitzende die Versammlung bereits geschlossen hatte.
Nun eröffnet Miitig am 19. Mai 2014 die Messe »Libya Build«. Über 120 internationale Firmen haben sich in die libysche Hauptstadt gewagt und die Reisewarnungen ihrer Botschaften ignoriert. »Libyen ist nicht Somalia, auch wenn die Medien es so darstellen«, erklärt ein italienischer Manager seine Zuversicht, bald wieder gute Geschäfte in Libyen zu machen. Neben Firmen aus Italien, dem ehemaligen Kolonialherren, sind es vor allem türkische, österreichische und maltesische Baufirmen, die rührig um Kunden werben.
Die über der pompösen Eröffnungszeremonie schwebende Kameradrohne steuert ein Gast aus Ravenna mit seinem Smartphone. Er hat bemerkt, dass der Scherz über die Drohne wohl keine gute Idee war, denn zahlreiche Explosionen hatten die Hauptstädter die letzten Nächte nicht schlafen lassen. »Wir haben uns für »Libya Build« wohl einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht«, bemerkt Mohamed Shannib Schulter zuckend. Der energische Ingenieur hat »Libya Build« auf die Beine gestellt und scheint seine Augen überall zu haben. Immer wieder schickt er die jungen Messehelfer fort, um kaputte Türen oder zu Stolperfallen gewordene Teppiche zu richten.
Eine Messe mit 500 Ausstellern in einer Stadt mit drei Millionen, deren öffentliche Ordnung seit drei Jahren nur durch den guten Willen ihrer Bürger aufrecht erhalten wird, ist eine Meisterleistung. »Ein Großprojekt wie dieses, ist zurzeit nur mit vielen guten Kontakten und viel Erfahrung möglich«, lacht Shennib. Polizei und Armee existieren in Libyen eigentlich nur auf den Lohnabrechnungen. Wie alle Staatsangestellten erhalten die Beamten ihre Gehälter, lassen aber die Uniformen lieber im Schrank.
Als Taxifahrer muss Ali Hamed nun mitansehen, wie bärtige Milizionäre die Macht auf den Straßen übernommen haben. »Wir werden jetzt von Lastwagenfahrern und Hilfsarbeitern regiert«, beschwert sich der Grenzpolizist, der sein schmales Gehalt in zivil aufbessert. Stolz zeigt er seinen Polizeiausweis. »Ich war drei Jahre auf der Polizeiakademie, so lange wie der dort auf der Kreuzung insgesamt in der Schule«. Ahmed zeigt auf einen jungen Mann in Kaki-Uniform und Kalaschnikow, der sich im Stau auf der Omar-Mukhtar-Straße »als Revolutionär ausgibt«, wie Ali spöttisch bemerkt.
Die wilden Handbewegungen behindern den Verkehr mehr, als dass sie ihn regeln. Vor dem Messeeingang springt ein Ausländer mit Aktenkoffer auf einen klapprigen Toyota. Der Malteser Geschäftsmann Claudio Penzano hat einen Termin im Wirtschaftsministerium. Die Zeit drängt. Denn in Libyens Behörden wird nicht mehr als drei Stunden am Tag gearbeitet, ab 13 Uhr schieben sich Blechlawinen voller brandneuer Autos Richtung stadtauswärts. Die zweite Tageshälfte verbringen die Libyer im nachrevolutionären Chaos mit sozialen Verpflichtungen.
Kinder müssen von der Schule abgeholt werden, Verwandte oder Nachbarn besucht werden. Schon am Mittag zeugen die zahlreichen Feuerwerke von Hochzeiten, das Leben geht seinen Gang. »Wir hatten auch unter Gaddafi Chaos«, sagt Ali. Der Staat war vor dem Februar 2011, als der Kampf gegen Gaddafi begann, die Summe seiner Bürger. Zuverlässig bekamen 70 Prozent der Arbeitnehmer ihren Lohn aus der Staatskasse, alles andere – von Müllabfuhr bis Altenbetreuung – wurde privat organisiert. Das dichte soziale Netz bewahrt das Sechs-Millionen Einwohnerland auch in dem jetzigen Chaos vor dem Totalabsturz.
Praktisch jeder ist Teil einer Großfamilie, einer Nachbarschaft oder eines Stammes. Soziale Regeln gelten oft seit Jahrhunderten – noch. Denn die junge Generation rebelliert gegen die alten Strukturen, auf die Gaddafi seine Macht aufbaute. Die jungen Leute waren es auch, die 2011 auf die Straße gingen, für Freiheit und Selbstbestimmung, nicht nur gegen Gaddafi. Gegen die grassierende Korruption und Vetternwirtschaft kämpfen einige nun in Milizen, als Aktivisten oder als Geschäftsleute. Ibrahim Ali hat im Mai 2011 die »Libya Transparency Association« gegründet.
Immer wieder deckt der Aktivist aus Benghazi Schmiergeldzahlungen auf, auch bei Verträgen mit ausländischen Firmen. »Die libysche Anti-Korruptionsgesetzgebung war schon unter Gaddafi schärfer als in Europa, aber versteckte Provisionen sind in unserer Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden – auch um Loyalitäten zu schaffen.« Auf der Messe verteilt Ali seine Broschüren und bittet ausländische Firmen um Unterstützung. »Wir müssen ein neues Wirtschaftssystem aufbauen, das nicht auf Bestechung fußt«. »Die Libyer haben so viel Zeit wie Öl«, seufzt Claudio Penzano matt, nachdem er im Ministerium vor verschlossenen Türen stand. »Mehr als zwei Termine am Tag schafft man nicht, häufig nur einen.«
Penzano verkauft Stromgeneratoren nach Libyen, ein lukratives Geschäft. Im Sommer kommt es im ganzen Land wegen der vielen Klimaanlagen immer wieder zu Stromausfällen. Nun sitzt die neue Ladung im Hafen von Tripolis fest. Es gibt nur drei Fahrzeuge, um die Container zu bewegen. »Der Hafen ist ein Nadelöhr im florierenden Handel mit Libyen«, sagt der smarte Mittvierziger, der seit mehr als zehn Jahren in Libyen Geschäfte macht. Malta ist wie vor der Revolution ein Sprungbrett für europäische Firmen.
Aufgrund der schlechten Sicherheitslage betreiben viele Firmen ihre Libyen-Niederlassung im Inselstaat, der weniger als eine Flugstunde von Tripolis entfernt liegt und Mitglied der EU ist. Penzano gibt sich optimistisch. »Die Leute haben mehr Geld als vor der Revolution und wollen Markenprodukte. Man braucht gute Kontakte, als Newcomer ist es schwer«, warnt er. Dass zwei Tage vor Eröffnung der »Libya Build« in Tripolis Kämpfe ausbrachen, bereitet ihm scheinbar weniger Kopfschmerzen. Es seien doch immer nur Milizen, die sich gegenseitig bekämpfen, versucht er zu beschwichtigen.
Sorgen bereiten ihm allerdings zunehmend der grassierende Waffen- und Drogenhandel auf der Straße. Vertreter vor Ort sehen die Lage meist entspannter als ihre Firmenzentralen. Doch Sicherheit ist auf der gut besuchten »Libya Build« Thema Nummer eins. Die Delegationen aus Spanien und Portugal reisten früher ab. Grund war die selbst ernannte »Nationalarmee« von General Khalifa Hafter, die zuerst in Bengasi und dann auch in Tripolis den islamistischen Milizen den Krieg erklärt hatte.
Mit der »Operation Karama« erklärte Hafter auch den Nationalkongress für abgesetzt. »Einige Abgeordnete unterstützen die Islamisten, die einen Gottesstaat wollen«, so Hafter. Mit Hafters Militärallianz, der sich viele Städte und Armeeeinheiten anschlossen, kamen aber auch die Misrata-Milizen nach Tripolis – um wiederum den Kongress zu schützen. »Diese Logik der Eskalation sehen wir seit drei Jahren im ganzen Land«, so Penzano, wir können nur abwarten bis sich die Lage beruhigt. Mal schauen, ob dann noch Geld in der Kasse ist.«
Neun Monate lang hatten die Föderalisten um Ibrahim Jadran mit der Blockade der vier Ölhäfen in der Provinz Cyrenika ihr Land von der einzigen Einnahmequelle abgeschnitten. Nach langen Verhandlungen und Entschädigungszahlungen in unbekannter Höhe erklärte sich Jadran schließlich bereit, den Job wiederanzutreten, mit dem die Regierung ihn ursprünglich beauftragt hatte – nämlich die Ölanlagen zu bewachen. Ein versuchter Ölexport mit einem unter nordkoreanischer Flagge fahrenden Tanker war von einer US-Spezialeinheit gestoppt worden.
Jadran, ein 31 Jahre alter Anti-Gaddafi- und Karate-Kämpfer, der seine Zelle im berüchtigten Tripolitaner Abu-Salim Gefängnis-mit Islamisten geteilt hatte, glaubte in Übergangspremier Abdullah Al-Thinni einen verlässlichen Verhandlungspartner gefunden zu haben. Ahmed Miitig hält er hingegen für einen Statthalter der Muslimbrüder – und schloss sich kurzerhand Hafter an. Mit den Föderalisten hat die »Karama«-Bewegung die zwei wichtigsten Ölhäfen unter ihrer Kontrolle gebracht.
Der Machtkampf in Libyen polarisiert das Land, dabei geht weniger um Ideologien als um den Zugriff auf die Öleinahmen. Vor allem die in Ägypten verfolgten Muslimbrüder und die mit ihnen verbündeten Islamisten sehen die Ölquellen Libyens als Geldquelle für ihre expansiven Ambitionen in Nordafrika. Auf den ungeteerten Straßen von Ibrahim Jadrans Heimatort Ajdabiya spürt man das allgegenwärtige Gefühl, von der Hauptstadt in den vergangenen Jahrzehnten übergangen worden zu sein.
Jadran findet in der Provinz Cyreneika große Unterstützung, dafür reicht schon seine Forderung nach transparenter und gerechtere Aufteilung des Öls. Die ostlibysche Provinz Cyreneika war zu Gaddafis Zeiten das Epizentrum des Widerstandes gegen dessen patriarchalische Herrschaft. Gaddafi ist tot, geblieben ist das Misstrauen gegen die übermächtige Hauptstadt.
»Ausländische Firmen werden zukünftig vor Ort mehr Verantwortung übernehmen müssen«
»Wieso sind die Golfstaaten so reich und Libyen als ölreichstes Land Afrikas so arm«, fragt Jadran gereizt auf die Frage nach seiner Vision für ein zukünftiges Libyen. Einen großzügigen Scheck in Höhe von 24 Millionen Dinar, mit dem der damalige Premier Ali Zeidan die Föderalisten die Freigabe der Häfen versüßen wollte, hielt Jadran im Oktober 2013 demonstrativ in die Kameras – und lehnte den vermeintlichen Bestechungsversuch ab. Dafür gewann er sogar bei Mitarbeitern von ausländischen Ölfirmen Respekt.
Mehrere internationale Angestellte der Waha Oil Company äußern Verständnis für den Widerstand gegen die korrupten Behörden in Tripolis. Ihre Arbeitgeber aber machen wegen der Blockade Milliardenverluste, Firmen wie Shell ziehen sich aus Libyen zurück und suchen neue Märkte. Dabei zeigte die deutsche Wintershall AG schon kurz nach dem Ende der Revolution, dass man auch unter widrigen Umständen Großprojekte in Libyen stemmen kann. Die Ingenieure Jens Balmer und sein libyscher Partner Hisham Shah planten in Rekordzeit 2012 den Neubau einer Pipeline von dem Ölfeld »C96« zum Knotenpunkt Amal südlich von Ajdabiya.
Das Herunterfahren der Produktion während des Krieges hatte die älteren Pipelines korrodieren lassen. Balmer und Shah ließen sich nicht von der unübersichtlichen Sicherheitslage abschrecken. Zusammen mit Mario Zoldan, Chefingenieur der italienischen Baufirma Bonatti, bauten sie mit einem hundertköpfigen Team eine 52 Kilometer lange Pipeline in den Wüstensand, als sich die meisten Firmen noch nicht ins Land trauten. »In dieser Pipeline schlägt das Herz des neuen Libyen«, sagte der 32-jährige Shah bei der Eröffnung des Vorzeigeprojektes. Das neue Libyen wird mit engagierter Arbeit und nicht Waffen gebaut.«
Die Wintershall AG ist als zweitgrößter Erdölproduzent Libyens mit einem alten Vertrag ausgestattet, die der BASF-Tochter aus Kassel mehr Verantwortung über die Bohrlöcher gibt. Wintershall will bleiben, die zahlreichen Blockade und das Chaos im Land aussitzen. Investiert hat der Konzern vor allem in seine libyschen Mitarbeiter. Während andere Öl-Giganten diese oft nur mitarbeiten lässt, werden sie bei Wintershall auch in Deutschland ausgebildet. Nach der Revolution verwalten sich die meisten Gemeinden gezwungenermaßen selbst. »Ausländische Firmen werden daher zukünftig vor Ort mehr Verantwortung übernehmen müssen und transparent in ihrer Arbeit sein, wir haben viele Gemeinden in unser Pipeline-Projekt eingebunden«, so Shah.
Das libysch-deutsche Krankenhaus wurde schnell zu einer stadtbekannten Erfolgsgeschichte
Bastian Greve wirkt unruhig. Das Mobiltelefon in seinem weißen Ärztekittel klingelt unaufhörlich. Der 35-jährige Krankenhausmanager leitet seit zwei Jahren das libysch-deutsche Krankenhaus in Benghazi. 600 Patienten behandelt das zehnköpfige Ärzteteam täglich in der Notaufnahme. Viele Opfer von Autounfällen, aber auch komplizierte Operationen, wie Greve betont. Nicht weit von der Vorzeigeklinik wurde kurz zuvor ein junger Mann aus dem Wrack seines um einen Laternenpfahl gewickelten Autos gezogen. Da sich die Polizei nicht auf der Straße blicken lässt, schert sich die Jugend in ihren aus Deutschland importierten BMWs nicht um Tempolimits.
Benghazi verbinden auch in Libyen viele nur mit Terror und Autobomben, meist trifft es Soldaten oder Polizisten. »Dabei findet trotz der Anschläge ein wahnsinniger Boom statt. Es fehlt zwar jegliche Regulierung, aber die wird durch soziale Kontrolle ersetzt«, sagt Greve. Überall in der Stadt entstehen Cafés und private Verkaufsgeschäfte. Das libysch-deutsche Krankenhaus wurde schnell zu einer stadtbekannten Erfolgsgeschichte. Die Ärzte Fahkri Alkaleifa und Tawfik Shembesh konnten einfach nicht mehr mit ansehen, dass ihre Landsleute Geld für gute Behandlungen nur im Ausland ausgaben.
Schon vor der Revolution finanzierte Libyen das Gesundheitssystem Tunesiens und Jordaniens indirekt mit, so Shembish. »An den staatlichen Kliniken ist die Behandlung vielleicht umsonst, aber auch schlecht«, bestätigt die Ärztin Layla Bughaigis. Die Aktivistin setzt sich für bessere Patientenrechte ein und wünscht sich mehr private Kliniken mit ausländischer Beteiligung in der Stadt. Die staatlichen Krankenhäuser schließen regelmäßig ganze Abteilungen aufgrund von Missmanagement. Greve ringt sich ein Lächeln ab. »Wir haben ein Qualitätsmanagement begonnen und 98 Prozent Zufriedenheit erreicht«.
Für Ärzte, Krankenschwestern und Patienten gelten die gleichen Regeln, erklärt der gebürtige Bocholter den Erfolg des Hauses, der zu schwarzen Zahlen schon im ersten Jahr führte. »Mit 15.000 Patienten in der Notaufnahme schaffen wir soviel Abrechnungsscheine wie 500 Ärzte in Mühlheim an der Ruhr, sagt Greve stolz. Neun Ärzte aus Deutschland wagen sich regelmäßig für zwei Wochenschichten in die Mittelmeer-Metropole in der Provinz Cyreneika, viele von ihnen betreiben zuhause private Praxen.
Die Immobilienpreise auf der Venedig-Straße in Benghazi können mittlerweile mit München mithalten
»Wir haben Erfolg, obwohl uns immer wieder Hindernisse in den Weg gelegt werden«, sagt Greve. Es dürfen keine Medizinprodukte aus der Schweiz einführt werden – ein Embargo das noch aus Gaddafis Zeiten stammt, als dessen Sohn Hannibal wegen Misshandlung eines Angestellten verhaftet wurde. Zur Strafe ließ der Diktator zwei Schweizer Geschäftsleute einsperren und verbot Schweizer Produkte. Aber auch aus Europa kommt wenig Hilfe. »Dabei übernehmen wir neben unserer Arbeit genau das, was in Libyen benötigt wird: die Ausbildung libyscher Ärzte und Krankenschwestern.«
In der Stadt muss das internationale Team zurzeit vorsichtig sein. Der Konflikt zwischen der Armee-Sondereinheit »Saiqa« und den islamistischen Milizen ist eskaliert. Ans Aufhören denken sie noch nicht, sagt eine philippinische Krankenschwester, »die libyschen Nachbarn passen auf uns auf.« Die 95 Betten werden knapp, sagt Greve nach einer Zwölf-Stunden-Schicht. Er ist enttäuscht, dass sich nicht einmal die deutsche Botschaft für das Projekt interessiert. Auf der Venedig-Straße eröffnete gerade das neueste von mittlerweile drei großen Einkaufszentren in Benghazi.
Neue Cafés mit riesigen Glasfronten locken Kunden an, Männer und Frauen sitzen aus Angst vor den Islamisten meist getrennt. Husni Bey, Libyens bekanntester Tycoon residiert in Tripolis. Seine ausgezeichneten Verbindungen sicherten ihm vor und nach der Revolution eine Vormachtstellung in Libyens boomender Privatwirtschaft und lockten Benetton, Marks and Spencer und Nike nach Libyen. Viele Exil-Libyer kehrten nach dem Ende der Kämpfe 2011 zurück in ihre Heimat, darunter besonders viele »Benghazinos«, wie sie sich nennen.
Die Immobilienpreise haben sich seitdem verzehnfacht und können auf der Venedig-Straße mit München mithalten. Die Sprachschulen sind voll, die jungen Leute pauken vor allem Englisch und Französisch. Um für den Fall eines Bürgerkrieges auch im Ausland eine Chance zu haben, sagt Nada Ebkoora augenzwinkernd. Die Halbtunesierin war Aktivistin der ersten Stunde. Sie trägt anders als ihre Freundinnen kein Kopftuch. Für das Kulturministerium kümmert sich Ebkoora um die florierende Zivilgesellschaft. »Sehen sie sich um«, sagt sie, »auf den 10 Privatuniversitäten der Stadt sind 70 Prozent der Studenten weiblich. Gerade wir jungen Frauen wollen in unserer Stadt etwas bewegen.«
»Wir haben auch ohne Öleinnahmen Geldreserven für fünf Jahre«, behauptet der Sprecher der libyschen Zentralbank
Nach dem Vorbild Misratas soll eine 1.200 Hektar große Freihandelszone entstehen. Geschäftsmann Mohamed breitet eine Karte auf der Motorhaube seines aus Deutschland importierten Mercedes aus. »Wir sind die Brücke zwischen Afrika und Europa. In der Cyreneika liegen die größten Ölvorräte Libyens und hier könnten die Ölfirmen ihre Hauptquartiere aufschlagen.« Die staatliche Fluglinie Libyan Airlines und ein Teil der Ölagentur NOC sind schon aus Tripolis zurückgekehrt. Fantastische Aussichten, macht sich Mohamed Mut.
Wären da nicht die Sorgen um die Sicherheit. Die Islamistenmiliz Ansar Scharia hat im Bezirk Hawari das Sagen, nur ins Zentrum trauen sie sich nicht. Drei mal haben die Bürger sie schon aus ihren von Gaddafis Truppen übernommen Kasernen vertrieben, jedes Mal kamen sie zurück. Mit der »Operation Karama« hat sich nun die Balance zugunsten der Armee verschoben. Viele Geschäftsleute unterstützen die Anti-Milizen-Bewegung, »egal wer ihr vorsteht«, sagen sie. Die Bürger wollen aus Benghazi die Wirtschaftshauptstadt machen, zu der sie 2012 von der Regierung offiziell ernannt wurde. »Aber die Milizen machen unsere Wirtschaft kaputt«, sagt Mohamed Kaplan.
Der Zahnarzt erzählt von einem Freund der eine Autowerkstatt aufgemacht hat und libysche Lehrlinge einstellen wollte. Viele hätten sich den Milizen angeschlossen, weil sie dafür 800 Dinar im Monat erhalten und nur einmal in der Woche Dienst schieben. »Wir haben niemanden gefunden, der für das gleiche Geld einen vernünftigen Beruf erlernen wollte«, sagt Kaplan. Sein Freund hat schließlich ägyptische Automechaniker eingestellt. Zusammen mit Mohamed Jaouda und anderen Freiwilligen macht Kaplan den Platz vor dem Königspalast sauber.
Jaouda ist an jedem Wochenende aktiv. In seiner Gruppe sind Hausfrauen, Rapper und Passanten, die stehen bleiben und einfach mitmachen. Auch zwei junge Salafisten fegen den »Platz der Armee«. »Nur wenn wir unsere unterschiedlichen Weltanschauungen akzeptieren und den jungen Leuten eine wirtschaftliche Perspektive bieten, können wir in Libyen Frieden schaffen«, sagt Jaouda energisch. Geld dafür wäre noch genug in der Staatskasse. 57 Milliarden US-Dollar beträgt der Staatshaushalt 2014, Tunesien kommt mit 10 Millionen Einwohnern mit 11 Milliarden US-Dollar aus.
Die libysche Zentralbank versucht Gerüchte über einen Staatsbankrott aufgrund des Ölboykotts zu zerstreuen. »Wir haben auch ohne Öleinnahmen Geldreserven für fünf Jahre«, behauptet Sprecher Issa Al-Kul. Er bestätigt, dass die Öleinnahmen 2013 von 4,6 Milliarden auf 1 Milliarde US-Dollar gesunken sind. Libyen ist trotzdem eines der wenigen Länder, dass keine Staatsschulden hat. Der Staatsfonds »Libyan Investment Authority« (LIA) verwaltet über 180 Milliarden im Ausland angelegte Dollar. Es bleiben also noch ein paar Jahre, die Wirtschaft umzubauen, alternative Energie- und Tourismuskonzepte sind in der Planung. Scheitern dürfen sie nicht. Wütende Proteste und die bewaffnete Blockaden der letzten Monate sind die Vorboten für den Fall, dass Libyen das Geld ausgeht.